Hoffen
Wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir fürchten, bestimmt.
Ernst Bloch
Wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir fürchten, bestimmt.
Ernst Bloch
Georg Stefan Troller hat in seinem Reporterleben Hunderte Prominente interviewt: von Muhammad Ali über Edith Piaf bis Woody Allen. Zu seinem 100. Geburtstag wird er selbst in einem Film überaus einfühlsam portraitiert von Ruth Rieser. Wie kann man mit Hundert geistig noch so unglaublich wach und präsent sein? Ein Film über das Leben und Überleben, die Liebe, das Unbegreifliche und Naheliegende, über Fragen und Sprechen und Raum geben, über die Verlebendigung des Gefühls im Dialog, über Freude, Verlust und Hoffnung, über Zugehörigkeit, Demut und den Sinn des Lebens – eine Lebensreise, zutiefst geprägt vom Humor und der Weisheit eines hundertjährigen Überlebenden aus Wien. Ein Lehrfilm für Therapeut:innen.
Leider ist der Film in der 3-sat Mediathek nicht mehr verfügbar, dafür:
Ein Gespräch mit Georg Stefan Troller in Paris

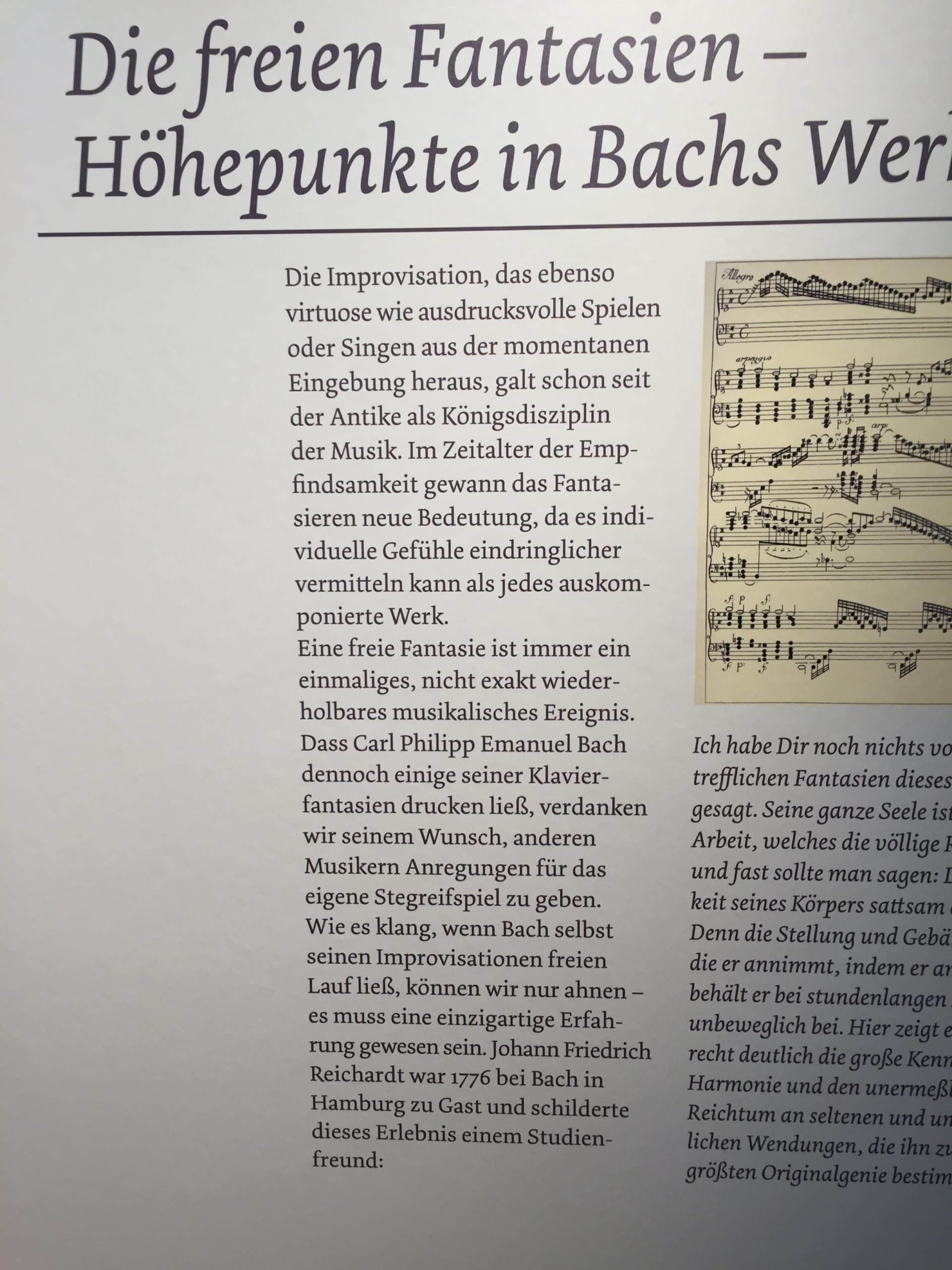
Aus der Sicht des Fußballtrainers ist leichter Sinn für mich verbunden mit der Sorglosigkeit, die ein Stürmer spürt, der in einer Saison aus jeder Situation trifft. Es gibt ja solche Jahre, in denen Stürmern alles gelingt, und solche, in denen nichts mehr klappt, obwohl dieser Stürmer seine fußballerischen Qualitäten nicht verloren hat. Mit einem leichten Sinn trifft er aus jeder Lage, vielleicht auch, weil er nicht nachdenkt. In schlechten Jahren schießt er dann aus drei Metern am leeren Tor vorbei.
(Hermann Gerland, Fußballtrainer)
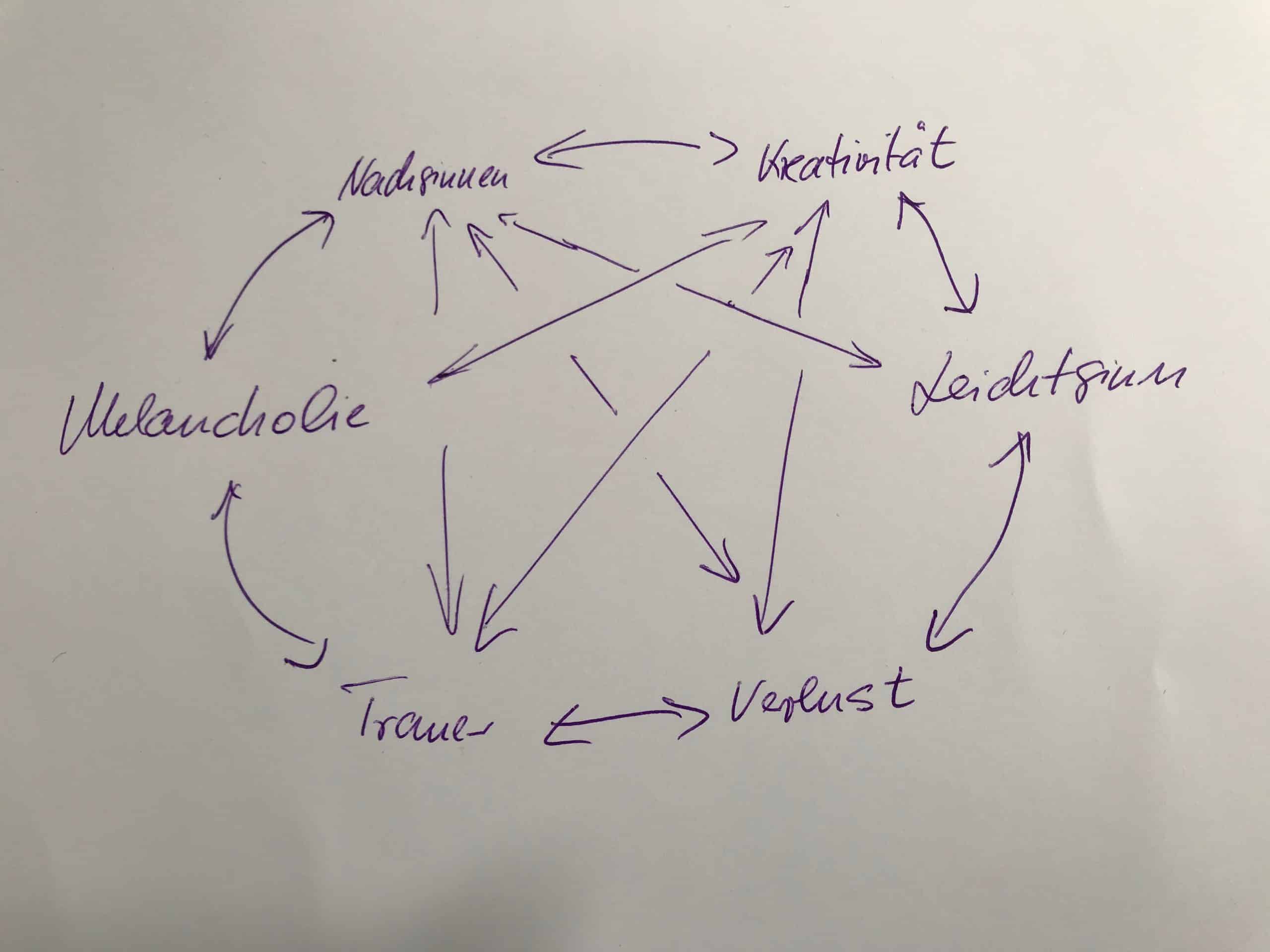
Philipp Ruch ist Philosoph und schreibt (ZEITMAGAZIN NR. 43/201817. OKTOBER 2018):
In Platons Politeia findet sich ein Satz, der mich immer wieder aufs Neue beeindruckt: „Denn alles Große verfällt leicht, und das Schöne ist in der Tat schwer, wie man sagt.“ In Anlehnung an dieses offenbar alltägliche Sprichwort im antiken Athen, das uns nur über die Politeia überliefert ist, lässt sich vielleicht etwas über den leichten Sinn sagen: Das Schwere leicht aussehen zu lassen, um eine Gesellschaft zu verzaubern, zu verstören oder zu inspirieren, scheint Teil einer Kontur zu sein, die die meisten künstlerischen Werke und Arbeiten, Inszenierungen, Musikstücke und Kinofilme durchzieht. Ohne diesen leichten Sinn für das Allerschwerste, das wahrlich Unmögliche, gäbe es Kunst vielleicht nicht. Die Kunst als Politik des leichten Sinnes für das Unmögliche.
Bildlich muss ich da zuallererst an unseren einsamen Drucker denken, der am Gezi-Park aus einem Hotel heraus über 1000 Flugblätter in ein autokratisches Regime hineingedruckt hat, per Cloud-Print. Wir haben ihn dort aufgestellt, im Gedenken an den 75. Todestag der Geschwister Scholl, und ihn mit erhöhter Papierzufuhr versehen, sodass er jene Blätter auf die Straße druckt, auf denen zum Sturz des Regimes aufgerufen wurde. Dieses leichte Segeln, dieser angelehnte Drucker, der simple Akt – das alles führt den Beweis, dass so etwas „Leichtes“ wie ein Flugblatt in einer Diktatur wie eine Explosion wirken kann. Das Schwere, der Drahtseilakt, das alles sieht hier so leicht aus. Es ist aller Angst, allen Schweißes und aller Mühen entkleidet, die bei vielen Menschen ein ganzes Jahr eingenommen haben.
Wir leben entspannter mit einem guten Kontakt zu unseren Schattenseiten, Schwächen und Ängsten. In sicheren Situationen und wertgeschätzt können wir sie anschauen und werden ruhiger. Gebundene Energie wird frei – Angst liefert Energie, das ist ihre überlebenswichtige Funktion – und wir entwickeln mehr Toleranz für uns selbst, für andere, für Ambiguität, das Aushalten offener Fragen und Situationen.
Selbstakzeptanz statt Selbstoptimierung (Willi Butollo).
„Tyll Ulenspiegel über uns drehte sich, langsam und nachlässig – nicht wie einer, der in Gefahr ist, sondern wie einer, der sich neugierig umsieht. Der rechte Fuß stand längs auf dem Seil, der linke quer, die Knie ein wenig gebeugt und die Fäuste in die Seite gestemmt. Und wir alle, die wir hochsahen, begriffe mit einem Mal, was Leichtigkeit war. Wir begriffen, was das Leben sein kann für einen, der wirklich tut, was er will, und nichts glaubt und keinem gehorcht…“
(Daniel Kehlmann, Tyll, S. 20)